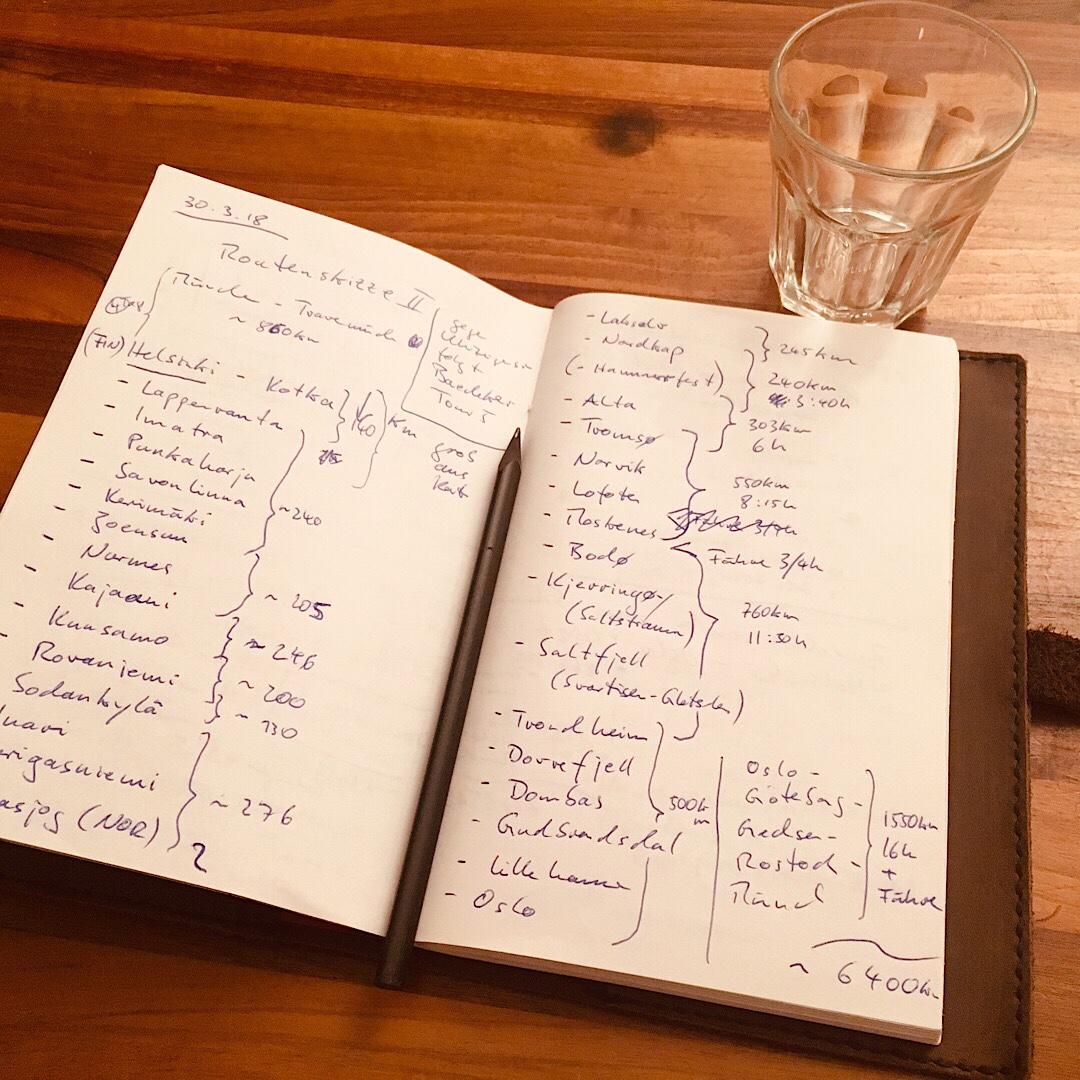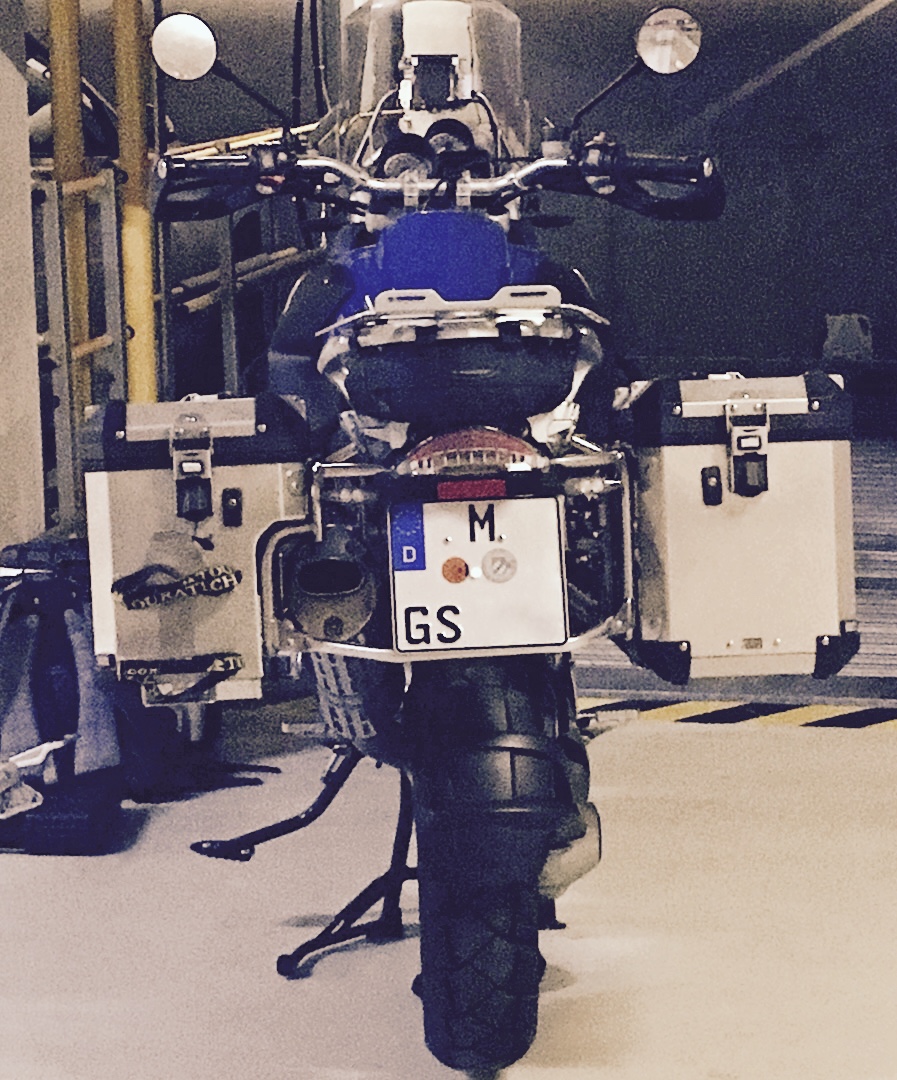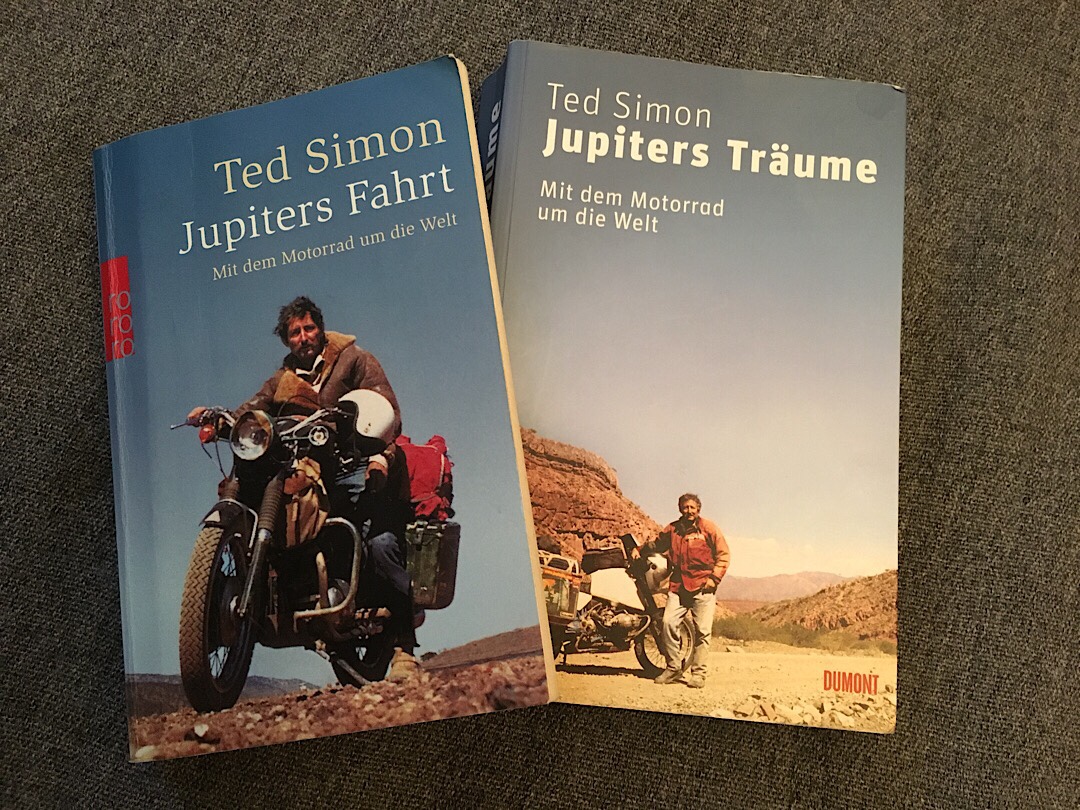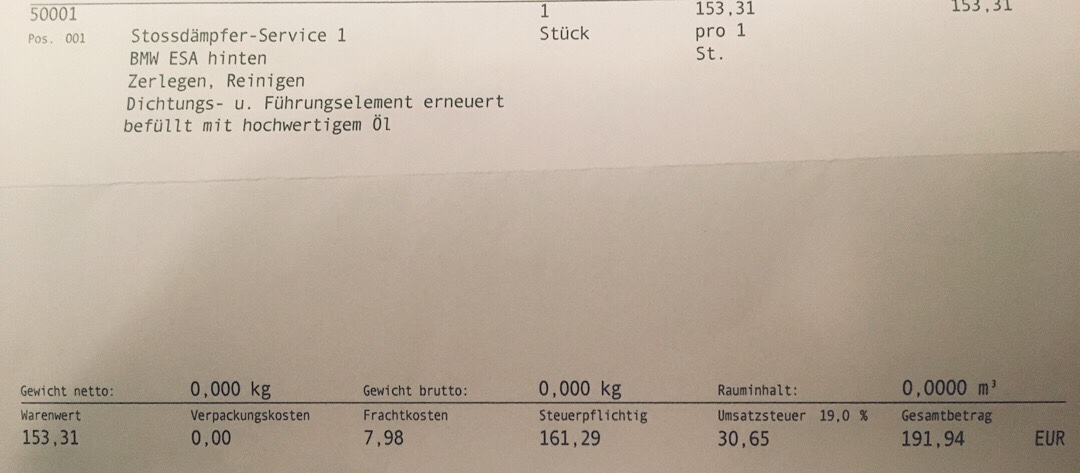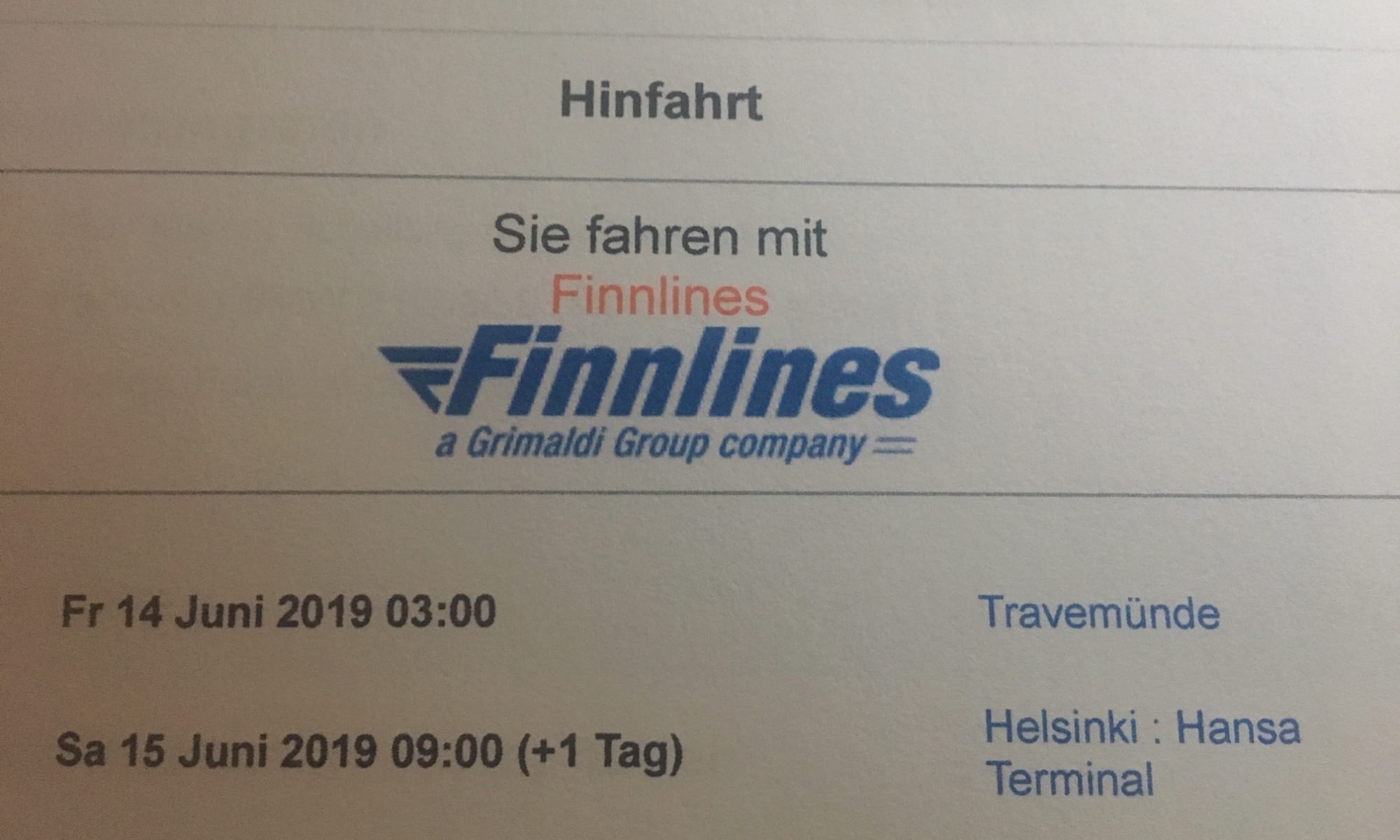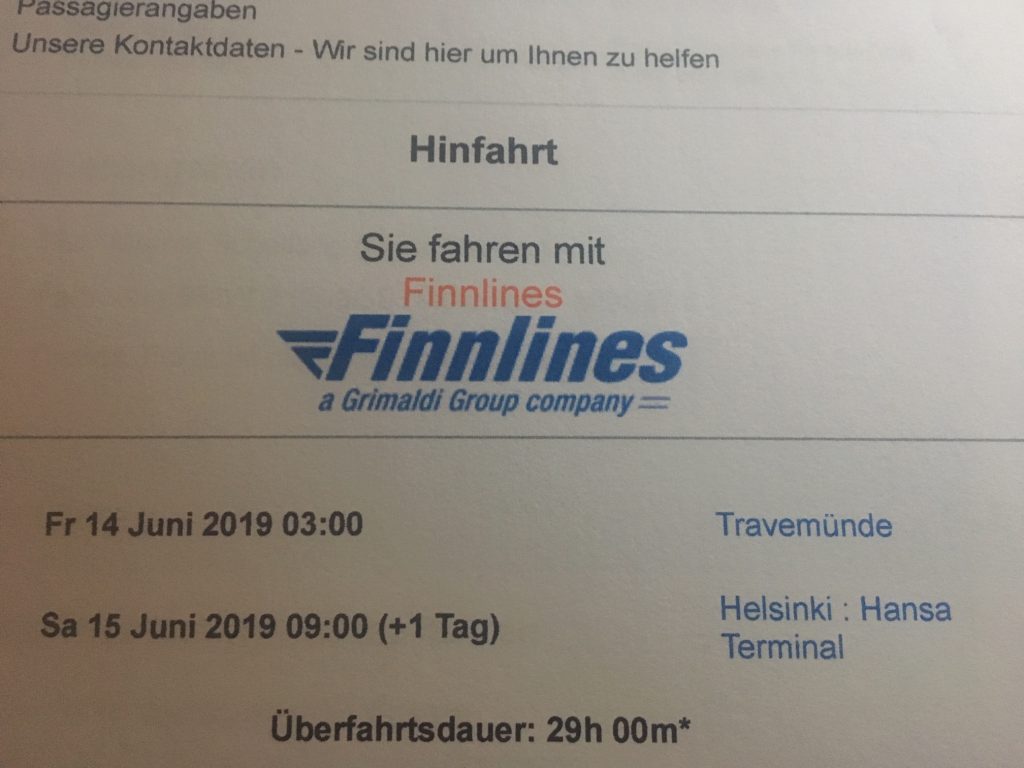Ich habe heute mal wieder durch das Buch Die obere Hälfte des Motorrads (2012) von Bernt Spiegel geblättert – ein großartiges Buch, weil es das Motorrad als Werkzeug fasst, den Menschen (die obere Hälfte) als Nutzer des Werkzeugs und Motorradfahren anthropologisch rekontextualisiert. Dabei bin ich wieder auf ein Thema gestoßen, das mich schon lange beschäftigt: Wie kann man das, was einen un(ter)bewusst lenkt, loslassen? Und wie kann man etwas sehen, das man nicht sehen kann?
Also, eine kleine harmlose Anekdote, die mir so auch nur einmal passiert: Ich bin auf dem Heimweg von Italien nach München, habe schon zu viele Regen-Kilometer an diesem Tag auf der Uhr, komme nach dem Brenner endlich in die Sonne und klemme mich wegen Tempolimit hinter einen großen Kastenwagen, versuche genug Abstand zu halten, freue mich über den Windschatten – das geht so über 10 Kilometer. Er bremst, ich bremse, er bremst stärker, ich bremse stärker – ich bin mit ihm ‘synchronisiert’. Irgendwann bremst er wieder, ich auch, er zieht rechts auf eine Abfahrt zum Parkplatz, ich auch, er hält an und mir fällt auf, dass ich überhaupt nicht auf den Parkplatz wollte. Ich war förmlich in Trance und habe mich von ihm leiten lassen. Das ist der eine Teil des Problems, um das es mir geht. Das andere beschreibt Bernt Spiegel für eine viel kritischere Situation:
Wir sind seit Beginn unserer Fahrpraxis daran gewöhnt – man kann ruhig sagen: darauf “abgerichtet” -, beim Hinterherfahren einigermaßen genau in der Spur des Vordermanns zu bleiben. […] Und wenn er [der Vordermann] noch mehr bremst, sodass wir es nicht mehr schaffen – nun, so bremsen wir, was wir nur können, halten jedoch auch weiter genau die Spur, so genau, als ob wir auf den Vordermann zielen würden. Je größer der Schreck, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, das wir ausbiegen. (S. 164)
Man lässt sich in einem solchen Moment nicht nur vom Vordermann leiten, man ist also auch nicht mehr in der Lage, an ihm ‘vorbeizusehen’, wenn er zum Problem wird. Spiegel greift bei seiner Begründung für dieses offenbar nicht untypische Verhalten auf die Wahrnehmungstheorie zurück, die das als “Figur-Grund-Problem” beschreibt. Der Vordermann ist die Figur, “das Thema”, das im Vordergrund unserer Wahrnehmung und damit auch handlungsleitend ist. “Je entsetzter der Nachfolgende darauf starrt, desto mehr. Sein Thema aber sollte die Lücke sein.” (S. 267) Und genau das ist der Kern dessen, was mich interessiert: Ich möchte in der Lage sein, aus der ‘Fremdsteuerung’ heraus und am Problem vorbeizudenken und die Lücke zu sehen, die ja Ausweg sein könnte – oft ist. Die lösungsorientierte Beratung kennt das aus anderer Perspektive als “Problemhypnose” (vgl. Günter Bamberger: Lösungsorientierte Beratung. 2010, S. 33ff.). Ein Problem steht so präsent und eindrücklich vor einem, dass es fast die gesamte Aufmerksamkeit braucht. Es will betrachtet und von allen Seiten beleuchtet, vielleicht sogar auf seine Ursprünge hin befragt werden. Das ist ja oft auch sehr sinnvoll, nur wenn das Problem und seine Betrachtung so viel Energie absorbiert, dass man dadurch nicht mehr in der Lage ist, daran vorbeizusehen, dann wird es mit dem Identifizieren von Lösungswegen immer komplizierter. Andererseits kann es auch nicht darum gehen, das Problem einfach nur auszublenden, denn es ist ja da (das Auto vor mir verschwindet leider nicht plötzlich, nur weil ich es nicht vor mir haben will; also zumindest reichen meine Jedikräfte dafür meistens nicht aus). Es geht also offenbar darum, das Problem in den Hintergrund und den Hintergrund, der eine Lösung beinhalten könnte, in den Vordergrund kippen zu lassen, um wieder handlungsfähig zu werden. Figur und Grund tauschen dann die Plätze. Das scheint nicht einfach zu sein, weil 1. das Problem eben unmittelbar im Nahfeld vor einem steht und, übertragen gesprochen, die Sicht versperrt. Und 2. weil man nicht gelernt hat, die Lücken zu sehen, die auf der Straße vor einem als Auswege vorhanden wären. Ich würde meine Wahrnehmung gerne darauf schulen, Auswege, Lücken und vor allem Lösungen zu sehen. Ein erster Schritt ist vielleicht, Probleme stärker auf Distanz zu mir zu setzen. Probleme sind eher unhöfliche Wesen, poltern durch die Türe und stehen oft unerwartet mitten im Raum. Vielleicht kann man ja reden mit ihnen: “Hallo Problem, ich habe heute gar nicht mit Dir gerechnet und offen gesagt, Du kommst gerade sehr ungelegen: Magst Du Dich kurz dort drüben hinsetzen, ich muss noch kurz etwas erledigen, dann kümmere ich mich um Dich.” Ok, das geht nicht gleich bei 130km/h auf der Autobahn – aber als Haltung könnte es helfen. Das Problem kann höflich gebeten, notfalls auch mit Nachdruck aus dem Blickfeld in den Hintergrund verbannt werden. Dann ist der Blick zumindest kurzfristig wieder frei. Für die Situationen bei 130km/h kann ein wenig mentales Training helfen, die Lücken und Fluchtwege im Blick zu behalten. “So sollte man sich […] im Selbstgespräch unter dem Helm alle paar Sekunden sagen hören: rechts – rechts – rechts – rechts – so, jetzt links – links – wieder rechts – rechts – noch rechts – wieder links -links usw. Entsprechend versetzt man sich dann schon eine Reifenbreite zur Seite […].” (Spiegel, S. 166) Man wäre also schneller in der Lage eine Lücke zu finden, weil man darauf ausgerichtet ist, dass es die Notwendigkeit einer Lücke geben könnte. Vielleicht ist das auch auf den Rest des Lebens übertragbar: Wie kann ich mich in die Lage bringen, am nächsten Problem, das bestimmt auftauchen wird, vorbeizukommen oder zumindest rasch vorbeiblicken zu können? Mich also gedanklich schon eine Reifenbreite zur Seite versetzen?
Ein gutes neues Jahr – mit vielen Lücken und wenig unhöflichen Problemen!